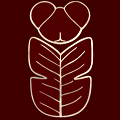
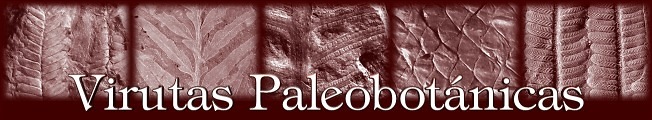
.
TRIAS VON SONORA
Die Untersuchung dieser Flora macht besondere Freude; denn sie stellt seit
Beginn der Makropaläobotanik von Mexico ihr Leitmotiv dar. Nur Ehrenberg
hatte schon vorher, Mitte des 19. Jahrhunderts, Süßwasserdiatomeen
der zentralmexikanischen Hochebene bearbeitet.
Die Erforschung der fossilen Gefäßpflanzen Mexikos setzte vor
1876 ein, dem Jahr der ersten Beschreibungen in einem kurzen Beitrag von
Newberry über triassische Blätter des Munizips von San Javier,
Sonora. Danach haben meistens Geologen auf Entdeckungsreisen in derselben
Folge, die lange als Formation Barranca bekannt war, fossile Pflanzen gesammelt:
Aguilera, Creel, King, Wilson & Rocha. Viel Material blieb jedoch unbeschrieben.
Nur Creels Fossilien wurden von Humphreys, 1916, in knappster Form samt einer
Illustration beschrieben. Die Fossilien von Wilson und Rocha befinden sich
in ausgelagerten Sammlungen des National Museum of Natural History (Smithsonian
Institution), Washington.
Mitte des vergangen Jahrhunderts haben Geologiestudenten, die Kohlelagerstätten
kartierten, ordentlicher gesammelt. Ihr Material wurde von Silva−Pineda,
1962, veröffentlicht. Gleichzeitig benannte Alencáster die zwischen
zwei Konglomeraten ruhende Formation Santa Clara (Karn und vielleicht bis
Nor?) als Glied der dreiteiligen Barranca−Gruppe. Unter dieser Gruppe liegt
marines Perm, und hangend folgen mesozoische Eruptivgesteine. Die Formation
Santa Clara führt Anthrazit und reichlich Graphit, die zwischen vorwiegend
kontinentale, oft pflanzenführende Schichten eingeschaltet sind; aber
es kommen auch geringmächtige Schichten mit marinen oder brackischen
Invertebraten und mächtige Folgen ohne Pflanzen vor.
1973 begann Weber ein neues paläobotanisches Projekt. Die Geländearbeit,
oft mit Studenten, dauerte bis 1997. Die Zahl der gesammelten Arten wuchs
dabei von etwa 20, 1962, auf 60−70 an. Als greifbares Resultat liegen eine
Sammlung von über 5000 Fossilien, publizierte Beschreibungen von Farnen,
Pteridospermen, Bennettiteen und Koniferen (siehe Bibliographie), sowie Diplomarbeiten
von Flor Amozurrutia−Silva, Alfonso Torres−Romo und Ángel Zambrano−García
(nur diese veröffentlicht), alle 1985, sowie Genaro Hernández−Castillo,
1995, vor.
Worauf zielte das paläobotanische Projekt hauptsächlich?
Vor allem wurden paläoökologische Untersuchungen begonnen, mit
dem Ziel, Pflanzengemeinschaften zu unterscheiden (vgl. Kapitel über
die Flora des untersten Jura von Bayreuth, Franken). Die Arbeit wurde in
drei Etappen ohne erhebliche Änderung der Ergebnisse, zuerst an 12,
und zum Schluß mit Material aus anstehenden Schichten von über
40 Fundpunkten (Stichproben) ausgeführt. Die modifizierte Methode von
Zürich−Montpellier, von Weber 1968 um Bayreuth angewandt, wurde erneut
modifiziert: Lithologisch eigenartige linsenförmige Gesteinskörper
wie dort sind in der Formation Santa Clara nicht gegeben. Stattdessen wurden
lithologisch homogene Schichtpakete bis 30 cm Mächtigkeit auf höchstens
etwa 3 m ‘horizontale’ Ausdehnung beprobt. Die Rohtabellen mit Fundpunkten
gegen Arten wurden nach Ausscheidung sehr seltener Arten und der Reproduktionsorgane
in der traditionellen Weise von Hand, aber auch mittels Berechnung von Korrelationsindizes
umgewandelt. Dank der Eigenart der Technik traten wie bei Bayreuth zwei gegensätzliche
Gruppen von Fundpunkten oder ‘Fossilgemeinschaften’ hervor, und weitere Arten
zusammen mit den ‘Ubiquisten’ stehen mit diesen Gruppen in keiner signifikanten
Beziehung. Eine der genannten Kontrastgruppen scheint oxydierende Umweltsbedingungen,
d. h. auch edaphisch sauerstoffreiche Standorte, beispielsweise an Flußufern
oder am Rand von Seen mit bewegtem Substrat zu bevorzugen, denn die Pflanzenreste
finden sich in hellem oder sehr hellem Gestein (mit wenig disperser organischer
Substanz), während die zweite vor allem in dunklen, manchmal fast schwarzen
Schichten, und vor allem in kohle− oder graphitführenden Profilabschnitten
vorkommt, also wohl die interfluviale Vegetation mit edaphisch sauerstoffarmen,
anoxischen oder gar reduzierenden Standortsbedingungen darstellt. Zur Gruppe
der Ubiquisten gehören drei Arten mit großer Standortstoleranz.
Diese Interpretation muß hypothetisch bleiben, solange eine regionale
sedimentologische Bearbeitung der Formation auf sich warten läßt.
Welche Pflanzen gehören zu dieser Flora?
(1) Die Sphenophyten sind mit drei oder vier Gattungen vertreten, zwei davon
mit ihren Reproduktionsorganen, Asinisetum Weber, in ms., mit drei Arten,
zur ersten ökologischen Gruppe gehörig, und der seltene Equisetites
aequecaliginosus Weber, in ms. Die fertigen Beschreibungen dieser Formen
sind in endlosen Herausgabeschwierigkeiten verfangen. Die weiteren sind fraglich.

Asterotheca santaclarae |

Tranquilia whitneyi |

Tranquilia whitneyi |
(2) Etwa 15 Farne, z.B. Tranquilia, ein heteromorpher Farn, und Asterotheca (Marattiales), die beide zur zweiten ökologischen Gruppe gehören, Mertensides (Gleicheniaceae), wohl auch von sauerstoffarmen Standorten; und weitere standortsindifferente, vor allem leptosporangiate Formen, darunter drei Cynepteris spp. (Cynepteridaceae), drei Phlebopteris spp. (Matoniaceae), die zu den ältesten der Gattung gehören. Phlebopteris weist in keiner gleichaltrigen Flora eine solche Artenzahl auf, und stammt vielleicht von hier.

Mertensides mexicanus |

Nicht bestimmter Farn |
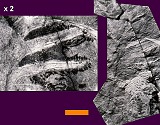
Sonoraphyllum mirabile |
(3) Die mesozoischen Pteridospermen sind als mögliche Vorfahren der Angiospermen faszinierend. Scoresbya, mit zwei Arten in Sonora und Sonoraphyllum gehören wahrscheinlich zu ihnen. Scoresbya dentata, die auch in Franken vorkommt, wurde von Weber (1995) nachgewiesen. Vorher war Scoresbya in Amerika nur in Grönland und den südlichen Shetland−Inseln zwischen Feuerland und der eisigen Antarktis gefunden worden. Von Sonoraphyllum dürfte weltweit bisher nur ein einziges Blatt vorliegen, das durch eine ‘unglaubliche’ Nervatur auffällt. Die Spreite ist fiederschnittig und die Sekundäradern richten sich auf die Buchten zwischen den Blattlappen. Kurz vor dem Buchtrand teilen sie sich dichotom, und die beiden Gabelnerven verlaufen je in einen von zwei benachbarten Blattlappen. Im Ergebnis hat jeder zwei Hauptadern. Bei der zweifelhaften Thinnfeldia, die von Brown in Material von Wilson und Rocha bestimmt wurde, handelt es sich in Wirklichkeit um die sterile Form des Farns Tranquilia.

Laurozamites fragilis |

Laurozamites fragilis |

Laurozamites pima |
(4) Die Cycadophyten sind mit den Farnen kodominant. Unter den Reproduktionsorganen fallen besonders die Bennettiteen Haitingeria, einziger Nachweis in Nordamerika, und Williamsonia und Dictyotrichia Weber, in ms. auf. Letztere finden sich stets zusammen mit Laurozamites−Arten. Der fast vergessene Gattungsname Macropterygium wurde wiederbelebt und die Gattung zum Ärger amerikanischer Kollegen neu gegliedert.

Weltrichia, sp. |

Elatocladus, sp. |

Nicht bestimmte Konifere |
(5) Ein oder zwei Ginkgoales−Arten, Gattung Sphenobaiera, und (6) einige Koniferen, einschließlich drei Elatocladus−Arten.
Das während dieses Projekts gesammelte Material wird in der Paläontologischen Nationalsammlung aufbewahrt.
Mehr Fotografien Und Kontakt
Fotogalerie:
TRIAS VON SONORA
Elektronische Post:
![]()
© 2004 - REINHARD WEBER
Instituto de Geología •
Universidad Nacional Autónoma de México
Ciudad Universitaria. 04510 Ciudad de México