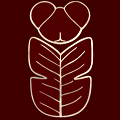
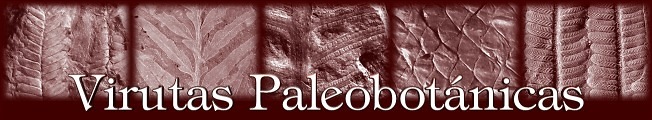
.
KREIDE VON COAHUILA
Obgleich dort schon früher Pflanzenfossilien beobachtet worden waren,
wurde die erste Sammlung für Forschungszwecke erst 1970/1971 von Weber
zusammengetragen. Die Formation Olmos (Unter−Maastrichtien), eine zwischen
marine, ebenfalls zur Oberkreide gehörende Formationen eingeschaltete
kontinentale Sedimentfolge, hellgrauer Schluff mit gelegentlich eingeschalteten
gelblichen, feinkörnigen Sandsteinen, entspricht einem Deltavorstoß.
Der Schluff repräsentiert energiearme Bedingungen, während die
Sandsteine, die oft silizifiziertes Holz führen, einen Energiezuwachs
anzeigen. An einigen Stellen gibt es Baumstämme, die wegen ihrer Länge
von manchmal mehreren Metern an einen versteinerten Wald denken lassen. Die
sedimentologischen Merkmale weisen darauf hin, daß die Formation nahezu
in Meereshöhe abgelagert wurde, und es ist anzunehmen, daß dort
Küstenlagunen, kleine Inseln und zusammenhängendere Landflächen
ein Mosaik bildeten.
Kohleflöze, die vor allem nahe der Basis der Formation auftreten, bezeugen
eine üppige, torfbildende Vegetation auf häufig von Süßwasser
überschwemmtem Grund. Gelegentlich zeigen sich Einflüsse von Salz−
oder Brackwasser. Die Arbeit unter Tage, vor allem in Barroterán und
Nueva Rosita, erleichterte die Fotografie oder Aufsammlung von ungewöhnlich
schönen Belegen, ganz oder teilweise schwarze Kompressionen von Blättern
und beblätterten Ästen. Diese Fossilien wurden an Schachtdecken
oder im Abraum sehr nahe am Kontakt mit der liegenden Kohle gesammelt, und
Manches spricht dafür, daß sie die produktive Vegetation darstellen.
Der Transport der manchmal sehr großen Pflanzenfragmente war geringfügig.
Bisher sind nur ein anfänglicher Überblick über die Flora
(Weber, 1972 [1973]), eine weitere über einige Angiospermen (Weber 1978
[1979]), sowie illustrierte Beschreibungen von Koniferen (Weber, 1975 y 1980
[1982]; Serlin, Delevoryas & Weber, 1981) und zwei wichtigen Wasserfarnen
(Weber, 1973, 1976) veröffentlicht. Außerdem ist eine vor diesem
Projekt abgeschlossene palynologische Dissertation von Rueda−Gaxiola über
die Kohle der Formation Olmos verfügbar.
Warum weiß man so wenig über die Flora der Formation Olmos?
Zur Enttäuschung des Sammlers haben die Blattkutikeln trotz der schwarzen
Farbe die Fossilisation nicht überstanden, die Nervatur ist nur bei
sehr wenig zarten Blättern von Farnen und Angiospermen, und weiter bei
zartesten Blättern von Wasserpflanzen zu erkennen. Ausserdem herrschen
ganzrandige Blätter vor. Die Angiospermenblätter zeigen hinsichtlich
Größe, Teilung, Rändern, und Textur eine große Klimaabhängigkeit,
was die Bedeutung dieser Merkmale bei der Suche nach der taxonomischen Stellung
schwächt. Der pflanzenführende Schluff zerfällt bei der Berührung
mit Wasser, was den Gebrauch einiger grundlegender Präparationstechniken
ausschließt. Dank dieser Merkmalsarmut ist die Wahrscheinlichkeit irriger
Bestimmungen vor allem bei den Angiospermenblättern sehr hoch, und setzt
eine erhebliche Toleranz gegenüber ungewisser Wissenschaft (scientia
incerta) voraus. Bei dieser Flora steht der Schönheit der Fossilien
die Ohnmacht sie zu verstehen folternd gegenüber.

cf. Tectaria, sp. |

Farnrhizom |
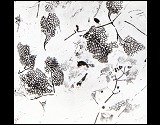
Salvinia coahuilensis |
Welche Pflanzen finden sich in dieser Flora?
(1) Zunächst seien sechs oder sieben Farne genannt, davon zwei Wasserfarne, Salvinia, einer der äußerst seltenen Nachweise in der Kreide, und Dorfiella, Erstfund einer später auch unter dem Synonym Hydropteris bekanntgemachten Gattung. Die Landfarne sind außer zwei sehr kleinen fertilen Bruchstücken durch nichtfruchtende Exemplare vertreten, die sich zur Bestimmung nicht gut eignen; und auch heute steht die Taxonomie der gleichaltrigen Farne von Kanada und den USA noch auf etwas schwankendem Grund. Nur Gleichenites kann mit Sicherheit in eine Familie gestellt werden (Morphogenus der Gleicheniaceae).
(2) Weiter fanden sich vier vegetative Koniferen, Brachyphyllum, Raritania, Metasequoia und Zweige, die wahrscheinlich zu den vorher nur aus Europa bekannten Zapfenschuppen namens Aachenia zu stellen sind, sowie einige Reproduktionsstrukturen.

Dorfiella auriculata |
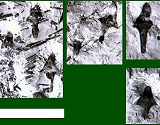
Aachenia knoblochii |

Sabalites, sp. |
(3) Außerdem fallen eine Reihe von Monokotylen auf, darunter zwei Arten Palmblätter, Hölzer und eine Infloreszenz derselben Familie, und schlecht erhaltene Blätter einer Pistia ähnelnden Wasserpflanze.
(4) Besonders stark treten die Dikotylen hervor, aber nur wenige Blätter können unter Zweifel zu heutigen Familien gestellt werden. Sicher sind jedoch die Magnoliaceae vertreten. Eine Art ähnelt Liriodendron, und wird mit Vorbehalt hier als Liriodendron alatum bezeichnet. Von besonderem Interesse ist ein Protolauracee. Das beste Fossil ist ein reich beblätterter Zweig, und die Blätter sind teils ungeteilt, teils zwei− oder dreilappig, ähnlich Sassfras. Die Blätter bilden Scheinwirtel mit bis drei agglomerierten Blättern je Wirtel. Diese Merkmale finden sich selbständig bei mehreren modernen Lauraceengattungen, aber alle gemeinsam scheints bei keiner Art mehr. In diesem Fall wird die Umschreibung einer Art sehr schwierig, weil die Blätter sehr variabel und zum Teil wohl den Variationsfächer anderer, wenigstens in der Literatur existierender Arten überlappen. Manihotites gehört nicht zu den Euphorbiaceae.

Infloreszenz einer Palme |

Pistia ähnliche Wasserpflanze |

Liriodendron alatum |
Mehr als 80% der Arten der Flora sind Abdrücke oder Kompressionen von Angiospermen, die wie große unter Tage beobachtete Wurzelsysteme in situ belegen, sehr wahrscheinlich meist Bäume waren. Die Koniferen stellen eine kleine Minderheit bei den Kompressionen. Viel geringer ist die Mannigfaltigkeit der Bäume, die durch an der Oberfläche häufiges Kieselholz vertreten sind, und die Koniferen dominieren völlig. Außerdem fanden sich nur ein paar Palmstämme und ein kleines Fragment eines Dikotylenholzes, was dazu anregt zu überlegen, wie repräsentativ für die Paläoökologie die Fossilien verschiedener Organe in verschiedener Erhaltung sein können.
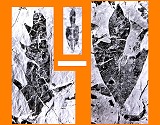
Protolauraceen−Blatt |

Protolauraceen−Blatt |
Es besteht kaum ein Zweifel: Was Makrofossilien betrifft, bieten die Fossillagerstätten mit Blättern (und beblätterten Achsen) vom Oberdevon an Fossilgemeinschaften, die den lebenden Gesellschaften nahestehen und sie am besten repräsentieren. Aufgrund der geringen Zahl beprobter Fundpunkte sowie den Schwierigkeiten bei der Bestimmung wurde die erwüschte paläoökologische Untersuchung nicht ausgeführt. Als kleinste Information sei das gemeinsame Vorkommen von Pflanzen der Baum− und der Krautschicht (Farne) im selben Habitat erwähnt.

Protolauraceen−Blatt |

Protolauraceen−Blatt? |
Das Material befindet sich in der Nationalen Paläontologischen Sammlung (Colección Nacional de Paleontología), UNAM.
Mehr Fotografien Und Kontakt
Fotogalerie:
KREIDE VON COAHUILA
Elektronische Post:
![]()
© 2004 - REINHARD WEBER
Instituto de Geología •
Universidad Nacional Autónoma de México
Ciudad Universitaria. 04510 Ciudad de México